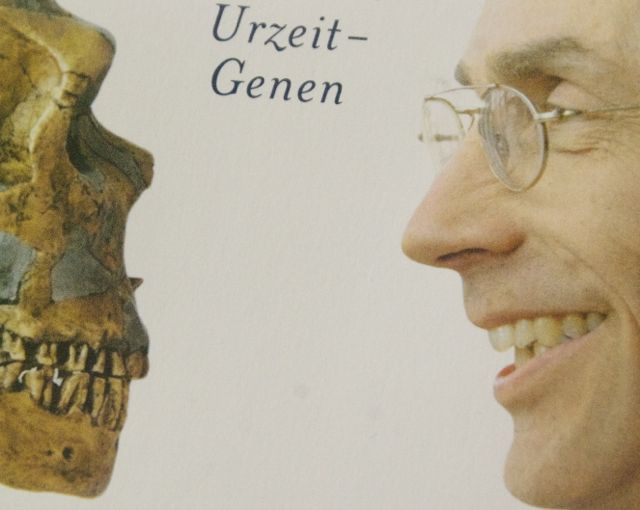Dieser Text erschien im Juli 2014 im gemeinsamen Nachrichten-Portal von web.de, gmx und 1&1. Weil der Blogbereich dort jedoch im April 2018 eingestellt wurde, gibt es den Beitrag jetzt hier im Volltext (vorher waren hier nur Teaser und Link).
Gentechnik an Nahrungspflanzen ist wie Sex in der Öffentlichkeit. Es kann aus moralischen Gründen abgelehnt werden. Aber nicht aus gesundheitlichen.
Vorletzte Woche erhielt ich eine Mail von einem Blog-Leser namens Marcel G.. Es war eine lange Mail. Eine sehr lange. Denn er wollte etwas loswerden. „In Bezug auf Gentechnik.“ Ein paar Zeilen später wurde klar, warum er mir so ausführlich seine Bedenken gegenüber dieser Technologie darlegt. Er schrieb, ich hätte gesagt, es gäbe „bis
jetzt keine negativen Konsequenzen aus Gentechnik. Das stimmt so nicht.“ Dann folgten aber nur eine Menge reichlich hypothetischer Gefahren, wie er auch selbst zugab.
Weil meine Antwort auf Marcels Mail immer länger und länger wurde und ich lauter Sachen schrieb, über die ich eh schon längst mal einen Blog-Text schreiben wollte, habe ich – in Absprache mit Marcel – beschlossen, öffentlich zu antworten.
Lieber Marcel,
ich würde mich gar nicht explizit als Befürworterin von Gentechnik bezeichnet. Weil sie mir eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich hab an Gentechnik kein persönliches Interesse. Weder finde ich sie besonders cool, noch denke ich, dass sie die einzige Lösung für
wichtige Welt-Probleme ist. Eigentlich denke ich „nur“, dass sie eine Technologie ist wie jede andere auch. Für mich als Biologin ist sie einfach neutral ein Werkzeug für Forschung und Anwendung.
Dass ich auch die Pflanzen-Gentechnik für eine normale Technik in der Züchtung halte, macht mich in den Augen von Gegnern aber natürlich zu einer von der Gegenseite. Denn dadurch sehe ich die Sache fundamental anders als z.B. du, für den es ganz selbsterklärend ist, dass diese Anwendung von Gentechnik riskant ist. Das liegt für Gegner auf der Hand. Es kann für sie gar nicht anders sein. Es ist für sie einfach offensichtlich, dass es sich bei Pflanzen-Gentechnik um etwas ganz Bedrohliches handelt.
Zwischen Befürwortern und Gegnern tut sich daher ein großer Graben auf. Für jemanden wie mich, der Gentechnik als normale Technologie sieht, reicht es, wenn Zulassungsbehörden und Wissenschaft feststellen, dass die Produkte dieser Technologie
sicher sind. Aber für jemanden, für den Gentechnik etwas völlig Neues, Mächtiges und �Unkontrollierbares ist, für jemanden, der sich gentechnisch veränderte Organismen als künstliche, tickende Zeitbomben vorstellt, den überzeugen offensichtlich keine
Sicherheitstests.
Auch du redest ja von den berühmten „unabsehbaren Folgen“. Du schreibst, eine Genpflanze sei vielleicht „nicht sofort giftig“, aber das heiße ja nicht, dass es nicht langfristig doch ungesund ist. Auch für die Umwelt beschwörst du namenlosen Schrecken, den man sich ja „ausmalen“ könne. Denn: „Sollte dann doch einmal etwas schief gehen (und das wird es, […]) dann ist es kaum umkehrbar“.
Du sagst von dir selbst, du seist einfach vorsichtiger und zu Recht weniger optimistisch als die Befürworter. Aber ich denke, das trifft es nicht. Denn die Art deiner Argumentation zeigt nicht etwa, dass du erstmal bei Anderen gucken will, wie’s läuft, dir mehr Zeit lässt
und abwartest. Nein, die Argumentation läuft drauf hinaus, dass man gentechnisch veränderte Pflanzen gar nicht anbauen oder essen sollte.
Und die beschworenen Gefahren sind so wolkig beschrieben, dass sie nicht testbar sind. Es sind so generelle Bedenken, dass man sie nicht ausräumen kann. Dass Gentechnik eine Gefahr ist, ist klar und soll – so wie ich es sehe – auch nicht widerlegbar sein. Damit wird
das Ganze in meinen Augen zum echten Vor-Urteil. Dass Genpflanzen“ gefährlich sind steht nicht am Ende deiner Argumentation, sondern ist ihr Anfang. So wie bei vielen
Anderen auch.
So erkläre ich mir jedenfalls das Phänomen, dass das Gefühl der Gegner, es hier mit etwas von Grund auf Schädlichem zu tun zu haben, offenbar schwerer wiegt als die hunderte von Studien, die keine negativen Folgen feststellen konnten. Dass es schwerer wiegt als das Urteil aller Behörden, von den deutschen (BfR) über die europäische (EFSA) bis zur weltweiten (WHO), die bisher weder gesundheitliche noch ökologische Gefahren nachweisen konnten. Dass es schwerer wiegt als die Erfahrung in anderen Ländern, wo die
Produkte ja schon jahrelang ohne Probleme konsumiert werden.
Und dieses schwer wiegende Bedrohungsgefühl ist längst immunisiert gegenüber der Frage, warum man die angebliche Gefährlichkeit von „Genfood“ denn nicht nachweisen könne. Wobei deine Zusatzannahme, um das zu erklären, ja glücklicherweise eher in die Richtung gehen, dass wir einfach noch nicht genügend wissen und verstanden hat, um die Folgen überhaupt abzusehen.
Ich war ja froh, dass du nicht zu den aggressiveren Zeitgenossen gehörst, die die NichtBeweisbarkeit ihrer Szenarien mit Verschwörungstheorien immunisieren. Mit der Annahme z.B., dass die Experten der Studien wahrscheinlich alle von den Unternehmen gekauft sind, die an den Produkten verdienen.
Wahrscheinlich würden diese Leute auch bei mir annehmen, dass ich auf der Lohnliste eines Saatgut-Unternehmens stehe, weil ich mich so hartnäckig weigere, Gentechnik als das Übel anzusehen, was es in ihren Augen ist. Aber ich kriege kein Geld von Gentech-Firmen. Ich bin nur eine kleine Biologin, Bloggerin und Wissenschaftsjournalistin, die ihre Meinung sagt.
Man kann mich auch schlecht als blind technologiegläubig bezeichnen. Ich verspreche mir von Gentechnik gar nichts Besonderes. Weder persönlich, noch gesellschaftlich. Es gibt ja
Leute, die meinen, dass Gentechnik helfen wird, endlich den Hunger der Welt zu stillen. Das glaube ich nicht. Vielleicht leistet es einen kleinen Beitrag. Aber den größeren müssten politische Maßnahmen leisten.
Nein, die beworbenen Vorteile von Gentechnik betreffen vor allem Landwirte, die das Saatgut gentechnisch veränderter Pflanzen kaufen. Die veränderten Eigenschaften der Pflanze sind abgestimmt auf sie als Kunden. Weniger Arbeit, weniger Risiko von Ernteausfällen, mehr Ertrag. Weil die Pflanzen diese Versprechungen meist auch halten, wird ihr Saatgut von den Bauern weltweit gekauft.
Für mich ist die Frage der Technologie, die für die Züchtung neuer Sorten verwendet wird, eine so neutrale, landwirtschaftsinterne Angelegenheit, dass es mir – um ehrlich zu sein schlicht egal ist, ob auf deutschen Feldern oder sonstwo nun gentechnisch veränderte
Pflanzen wachsen oder nicht. Ich habe keine eigenen Wünsche oder Hoffnungen dazu.
Was mich aufregt, ist nur das gestörte Verhältnis von Gentechnik-Gegnern zur Wissenschaft. Weil ihre Argumentation oft so pseudowissenschaftlich ist. Sie tun so als interessierten sie sich für die Ergebnisse von Studien. Aber dann akzeptieren sie nur die,
bei denen das rauskommt, was sie erwarten. Und das sind nur wenige, kleine, schlecht gemachte Studien.
Das regt mich auf. Aber sonst?
Ich denke sogar oft: Naja, wenn alle meinen, das sei gefährlich, dann gibt es in Deutschland halt keine Lebensmittel, die mit Hilfe von Pflanzen-Gentechnik hergestellt wurden. Das ist Demokratie, oder? Wenn sich die Mehrheit von etwas bedroht fühlt, dann lassen wir das halt. Inzwischen bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob das die richtige Haltung ist. Sollte man es wirklich so schulterzuckend hinnehmen, wenn die Politik sich an diffusen �Bedrohungsgefühle aus dem Bauch des Volkes orientiert, die pseudowissenschaftlich
untermauert werden? In anderen Politik-Feldern nennen wir so was Populismus.
Sagen wir mal so: Dass Studien zur Sicherheit von „Genfood“, die von
Zulassungsbehörden und Sicherheits-Forschern weltweit durchgeführt wurden, bisher keine negativen Effekte messen konnten, könnte in einem sehr unwahrscheinlichen Szenario heißen, dass alle Wissenschaftler bisher irgendwas Wichtiges übersehen haben. Die wahrscheinlichste Erklärung ist aber:
Dass es schlicht keine negativen Effekte gibt!
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber wenn jemand diese für mich einfachste und logischste Erklärungsmöglichkeit so gar nicht auf dem Schirm hat, dann wittere ich bei meinem Gegenüber eher moralische Gründe für die Ablehnung. Denn natürlich kann man
eine ganze Technologie wie die Gentechnik aus moralischen Gründen ablehnen. Das ist legitim. Was soll man dagegen sagen? Mit Gentechnik-Gegnern, die moralische Grenzen als Grund für ihre Ablehnung angeben, komme ich eigentlich auch am besten klar. Sie sind ehrlich und bei ihnen ist klar, auf welchem Boden die Diskussion stattfindet.
Viel schwieriger finde ich es, wenn jemand meint, er argumentiere auf der rationalen Ebene, sich die Argumente aber überhaupt nicht danach anhören. Wenn jemand Gentechnik verwerflich findet, aber nicht über diese empfundene Unmoral redet, sondern nur über die von ihm daraus gefolgerten Erwartungen an die Fakten.
Würde man die Argumentationen vollständig hinschreiben, sähen sie so aus: „Weil die Manipulation von Genen für mich die Überschreitung eines Tabus ist, erwarte ich, dass diese Handlung auch gefährlich sein muss und schlimme Konsequenzen hat.“ Oder so: „Weil ich es moralisch abstoßend findet, wie das Produkt hergestellt wird, erwarte ich, dass dieses Produkt auch schädlich sein muss, z.B. giftig für den Menschen oder die Umwelt.“
Aber eine solche Argumentation ist unzulässig, weil sie auf einem sogenannten moralistischen Fehlschluss beruht. Tatsächlich gibt es nämlich keinen solchen Zusammenhang zwischen dem, was Menschen moralisch gut oder böse finden und den wissenschaftlich nachweisbaren Eigenschaften von Dingen und wie sie auf uns wirken. Es gibt seit Jahrzehnten sehr gute Tests und Studien-Designs, um festzustellen, ob etwas giftig ist oder sonstwie schädlich. Ob ein Stoff die Haut reizt oder besonders allergen ist, �ob er leberschädigend ist oder krebserregend, ob er Wasserlebewesen schädigt oder Bienen. Das können wir alles gut feststellen. Und das ist sehr wichtig.
Aber dabei hat sich eins sehr deutlich gezeigt: Ob ein Stoff künstlich hergestellt wurde oder natürlich vorkommt, erlaubt keinerlei Vorhersage darüber, ob dieser Stoff schädlich ist. Natürliche Stoffe können schädlicher sein als künstliche. Und künstliche können z.B. als Medikament wirksamer sein als natürliche. Und anders rum. Es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen Ursprung des Stoffes und seiner Wirkung. Entscheidend sind allein seine chemisch-physikalischen Eigenschaften.
Gleiches gilt für gentechnisch veränderte Organismen. Natürlich könnten wir Lebewesen gentechnisch so verändern, dass sie uns danach schaden. Etwa wenn jemand einen Krankheitserreger im Labor gentechnisch so verändert, dass er gefährlicher wird. Aber dann ist dieser Erreger schädlicher, weil die reingebrachte Eigenschaft sein Potential erhöht hat uns krank zu machen, und nicht weil die Integration auf gentechnischem Wege passierte.
Wenn dieser Erreger das Gen auf natürlichem Wege durch Austausch mit seinen Bakterien-Kollegen erhalten würde, hätte er danach das genau gleiche erhöhte Potential uns krank zu machen. Für die erzielte Wirkung ist nämlich der Weg der Entstehung völlig
unerheblich.
Wenn etwas von uns Menschen künstlich verändert wird, lässt das keine Vorhersage darüber zu, ob es danach harmloser oder schädlicher ist als das natürliche Pendant. Es ist beides möglich. Je nachdem, was wir ändern. Denkbar ist ja genauso, dass wir eine
Pflanze, die für uns normal giftig wäre, dadurch essbar machen. Wenn wir das Gen für den Giftstoff gentechnisch aus dem Erbgut der Pflanze entfernen, dann würde sie, die sonst für uns giftig ist, in ihrer gentechnisch veränderten Version plötzlich genießbar.
Die durch Gentechnik eingebrachten Veränderungen an Nahrungspflanzen werden aber in der Praxis so ausgesucht, dass sie für uns als Esser gar nichts ändern. Sie sollen für den Konsumenten ja neutral sein. Dass das auch so ist, muss man natürlich überprüfen. Aber das kann man ja und das tut man auch. Ob uns oder anderen Organismen etwas schadet, ist ja etwas Messbares. Unabhängig von der moralischen Bewertung der Prozesse, lassen sich die realen Wirkungen bestimmen, die die beteiligten Stoffe aufgrund ihrer chemisch-physikalisch-biologischen Eigenschaften haben.
Man kann nur mit naturwissenschaftlichen Methoden zeigen, ob etwas schädlich ist oder unbedenklich. Wie denn sonst? Wenn es diese Frage ist, die man gerne geklärt haben will, dann gibt es keine Alternative zu wissenschaftlichen Studien. Aber ist es überhaupt diese Frage, die Gegner wirklich umtreibt?
Ein wichtiger Schritt, um das zu klären, ist folgende Frage: Warum sind Gentechnik-Gegner nicht erleichtert, wenn Studien zeigen, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze doch nicht gefährlich ist? Denn das wäre doch die normale Reaktion, wenn man Gegner ist, weil man vorsichtig, pessimistisch oder ängstlich ist im Hinblick auf eine neue Technik, und dann rauskommt, dass man seine Vorsicht ablegen kann.
Warum ist die übliche Reaktion nicht Erleichterung, sondern Wut? Und warum passt es Gentechnik-Gegnern so dermaßen nicht in den Kram, dass „Genfood“ harmlos ist? Wenn man mit der Wissenschaft unzufrieden ist und die hundertste Studie, die Unbedenklichkeit attestiert, auch wieder wütend ablehnt, dann sollte man vielleicht ehrlich zu sich und zur Welt sein und sagen: Mir ist egal, ob das Zeug unbedenklich ist oder nicht, denn ich lehne es aus ganz anderen Gründen ab. Aus moralischen.
Dieses Eingeständnis fände ich persönlich nicht nur völlig legitim, sondern auch notwendig. Es ist ja wichtig zu wissen, warum man etwas ablehnt. Es gibt viele Sachen, die ich aus moralischen Gründen ablehne. Sex in der Einkaufszone zum Beispiel. Und mein Urteil in dieser Sache ist ganz unabhängig davon, welche rationalen Gründe es dafür oder dagegen geben sollte. Auch wenn man mir nachweisen
würde, dass öffentlicher Sex gesundheitlich unbedenklich wäre und vielleicht sogar nützlich – ich würde ihn trotzdem ablehnen.
Und weil es eine moralische Frage ist, lehne ich dieses Verhalten nicht nur für mich ab, sondern würde auch nicht wollen, dass es Andere machen. Weil es mir unangenehm ist. Weil es für mich eine fühlbare Grenze überschreitet. Mir ist dabei aber bewusst, dass diese Grenze eine ist, die aus Normen und Werten in mir
und um mich herum entstanden ist. Durch die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Ich könnte für diese Grenze keine rationalen, wissenschaftlichen Gründe finden. Ich käme auch
nicht auf die Idee, welche zu suchen. Weil es keine gibt.
Das, was mich bei der Gentechnik-Diskussion fertig macht, ist nicht, dass Menschen wie du sie ablehnen, damit habe ich – wie gesagt – kein Problem, sondern nur, dass du und so viele Andere versuchen ihre moralischen Grenze in dieser Sache mit Schein-Argumenten
auf der Sach-Ebene zu verteidigen. Das ist so als würde jemand öffentlichen Sex verbieten wollen mit der Begründung, dass er
ganz bestimmt gesundheitsschädlich ist. Das ist ein absurder, unzulässiger Übergang zwischen moralischer und wissenschaftlicher Argumentation. Noch absurder wäre es nur,
wenn man es dann der Wissenschaft vorwirft, dass Studien die erwartete Gesundheitsschädlichkeit von öffentlichem Sex nicht zeigen können.
Genau sowas machen Gentechnik-Gegner ständig. Sie stellen die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in Frage, nur weil sie erwarten, dass wissenschaftliche Studien auf Sach-Ebene bestätigen, was sie selbst als Grenzüberschreitung empfinden. Und wenn die Wissenschaft das nicht bestätigt, dann nehmen sie an, dass mit der Studie, dem Forscher oder sogar der gesamten Wissenschaft was nicht stimmt.
Aber das einzige, womit was nicht stimmt, ist die Erwartung, dass sowas wie Schädlichkeit mit einer gefühlten Verwerflichkeit Hand in Hand gehen muss. Die Erwartung, dass Wissenschaft Gründe für ein moralisches Urteil liefern kann. Das kann sie nicht. Weil es
diesen Zusammenhang nicht gibt. Weil Moral etwas ist, was Menschen empfinden, was sie in Regeln gießen und tradieren, aber nicht etwas, was man messen kann oder auch nur aus
Messungen folgern kann.
Ich will dir deine Ablehnung der Pflanzen-Gentechnik nicht ausreden. Die ist ok. Aber ich habe einen Wunsch: Bitte untergrabe nicht dein Vertrauen in die Wissenschaft oder das der Anderen, indem du den Forschern vorwirfst keine rationalen Gründe für ein Verbot liefern zu können. Auch wenn es niemals sachliche Argumente gegen die Gentechnik geben sollte, kannst du sie weiterhin ablehnen. Aus völlig legitimen, aber eben
moralischen Gründen. Danke!
Mit besten Grüßen,
Brynja
Nachtrag vom 6.7.14, 18:20: Wer sich, bevor er sich hier in die Debatte schmeißt, auf den neuesten Stand bringen will, was die Wissenschaft zum Thema Pflanzen-Gentechnik überhaupt so sagt, auch interdisziplinär, dem sei die Kurzfassung des aktuellen Gentechnologie-Bericht empfohlen. Oder überhaupt das ganze Informationsangebot gentechnologiebericht.de